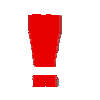 Achtung!
Achtung!
Die Webseiten des Mantis-Verlags wurden im Februar 2010 komplett umgestaltet. Diese Seite ist veraltet und wird nicht mehr gepflegt.
Bitte besuchen Sie stattdessen die neue Startseite von http://www.mantis-verlag.de/ oder alternativ http://www.fantomzeit.de/.
Signale für einen Paradigmenwechsel
von Heribert Illig und Hans-Ulrich Niemitz (Aus der österreichischen "GEGENWART" 3-4/96)
Es begann alles ganz einfach. Den einen von uns faszinierte die unglaubliche Fülle mittelalterlicher Fälschungen. Deren Umfang läßt sich allenfalls mit einem Vergleich veranschaulichen. 1986 veranstaltete die Monumenta Germaniae Historica. Deutsches Institut für Erforschung des Mittelalters, also die einschlägige Institution, einen großen Kongreß zum Thema "Fälschungen im Mittelalter". Allein die Protokolle dieses Kongresses füllten fünf Bände mit mehr als 3.700 Seiten. Es dürfte wenige mittelalterliche Phänomene geben, die in ihrer Fülle wie in ihrer Vielgestaltigkeit, auch in ihrer Anmaßung und Selbstverständlichkeit die Forscher noch mehr verwirren und damit noch stärker herausfordern würden
.
Besonders rätselhaft erscheint die Mentalität der Fälscher, wie sie Horst Fuhrmann, damals Präsident der Monumenta, in der Eröffnungsrede dieses Kongresses dargestellt hat. Er konzentrierte sich auf die umfangreichsten und entscheidendsten Fälschungen, so auf die "Konstantinische Schenkung", die den Kirchenstaat begründen sollte, so auf die "Pseudoisidorischen Fälschungen", eine Sammlung von über 10.000 kirchenrechtlich bedeutsamen Dokumenten. Alle diese Fälschungen entsprängen einem dubiosen Verfahren, denn sie seien -trotz aufwendiger und mühseliger Anfertigung- erst "Jahrhunderte später [...] in das Bild von Welt und Kirche eingebaut worden" (Fuhrmann 1988:90). Fuhrmann vertrat die Ansicht, daß erst das Umfeld bestehen mußte, um eine Fälschung wirken zu lassen:
"Es ist ein naiver Positivismus, wenn man meint, Fälschungen der hier vorgeführten Art hätten die Welt verändert. Ein solcher Satz vertauscht Ursache und Wirkung: vielmehr hat eine entsprechend veränderte Welt die Fälschungen aufgenommen. Oder anders ausgedrückt: Der sich herausbildende Zentralismus des Papsttums hatte die Fälschungen nicht nötig; wohl aber hatten die Fälschungen für ihren Erfolg den Zentralismus des Papsttums nötig" (Fuhrmann 1988:91).
Geht es denn noch seltsamer: Die Kirche fälscht, ohne es nötig zu haben (Niemitz 1/91)? Damals wurde auch der andere der beiden Verfasser mit diesen Fragen konfrontiert. Wir diskutierten Fuhrmanns Bild und fanden es absurd: Da erfinden kluge Mönche hochbrisante Dokumente-doch zu niemandes Nutz und Frommen. Statt dessen verstauen sie ihre Machwerke in einer Schublade, bis nach Jahrhunderten die Welt sie ans Licht hebt und "aufnimmt"? Wie gelingt es, die Zukunft so gut einzuschätzen, wie untermauert man zukünftige Ansprüche eines noch ungeborenen Potentaten, wieviele Varianten muß man prophylaktisch fälschen? Mönche als Hellseher?
Bald fragten wir uns, ob nicht etwa der große Fuhrmann wiederum Ursache und Wirkung vertauscht hatte. Daraus entstand die These: Wenn die Fälschungen Jahrhunderte später zweckmäßig werden konnten, liegt das daran, daß der Zeitpunkt der Fälschung und der Zeitpunkt ihres Einsatzes dicht beieinander lagen, später aber durch eine Manipulation an der Zeitachse weit voneinander getrennt wurden. Dafür gab es eine Kontrollmöglichkeit: Unser Kalender ist 1582 korrigiert worden, um die seit Caesars Zeiten zu häufig eingesetzten Schalttage auszugleichen. Diese Korrektur geschah durch das Überspringen von zehn Tagen. Da Caesars wie Gregors XIII. Reformen zeitlich fixiert sind, läßt sich nachrechnen, ob richtig korrigiert worden ist. Diese Rechnung ist ebenso einfach, wie ihr Ergebnis überraschend ist: Man sprang um drei Tage zu kurz -und trotzdem sind heute Himmel und Kalender im Einklang. Die Konsequenz: Die Zeitspanne zwischen Caesar und Gregor muß zirka 300 Jahre kürzer als bislang angenommen sein (Illig 1/91)
.
Zwischen der Antike und der Renaissance führen die Historiker rund 300 Jahre zuviel in der Chronologie. Auf Christi Geburt bezogen leben wir heute nicht im 20., sondern gerade noch im 17. Jahrhundert n. Chr., vielleicht im Jahre 1699. Drei Phantom-Jahrhunderte auf der Zeitachse - wo wären sie aufzuspüren? Nun sind im frühen Mittelalter die dunkelsten, das heißt unbekanntesten Zeiten abendländischer Geschichte angesiedelt. Angesichts der dortigen Fund- und Problemlage ließ sich die These drastisch verschärfen: Die Phantomzeit liegt -so der bisherige Befund- zwischen den Jahren 614 und 911. Diese Zeit und die ihr zugeordneten Ereignisse hat es nie gegeben. Sie ist irgendwann in unsere Zeitrechnung eingefügt worden und deshalb absolut leer. Bauten und Artefakte, die dieser Phantomzeit angehören sollen, sind ihr erst später zugeschrieben worden (lllig 4/92a).
Darauf stellten sich tausend Fragen. Die beiden nächstliegenden waren: Warum haben andere diesen Zeitfehler nicht längst bemerkt? Und zweitens: Wenn wir schon eine Hypothese von so großer Tragweite aufstellen, dann müssen sich dadurch sehr viele quälende Probleme lösen. Hat die einschlägige Forschung überhaupt so viele Probleme? Auf die erste Frage gab es sofort eine Antwort: Zeitachse und christlicher Kalender sind so selbstverständlich, daß niemand auf die Idee gekommen ist, sie in Frage zu stellen. Dabei sind beide kein Gottesgeschenk, sondern nur ein fehleranfälliges Rechenergebnis. Als wir nun in den verschiedensten Fachgebieten die Literatur zu Spätantike und Frühmittelalter studierten, fanden wir Forschungsprobleme en masse, aber kein Problembewußtsein. Die chronologiegläubigen Spezialisten wundern sich immer nur kurz, fühlen sich aber in Einklang mit ihren Nachbar-Disziplinen und können ungestört weiterarbeiten. Das gilt für Archäologen wie Historiker, Städteforscher wie Münzkundler, Siedlungsarchäologen wie Radiokarbon- und Dendrochronologie-Datierer, Keramikspezialisten wie Kirchengeschichtler, Byzantinisten wie Islamforscher. Wir dagegen nahmen die Probleme als Probleme und prüften an ihnen die Phantomzeit-These, wobei wir alle Synchronismen von Island bis Indien beachteten. Aus der Fülle der Forschungsprobleme wollen wir hier nur sechs Beispiele kurz anreißen.
Die Parsen -das sind die Feueranbeter beziehungsweise Zarathustra-Anhänger, von denen ein Teil aus dem Iran nach Indien floh- streiten über ihre eigene Chronologie. Als im 18. Jahrhundert Botschafter vom Iran nach Indien kamen, um eine religiöse Wiedervereinigung zu versuchen, teilten sie den indischen Parsen mit, daß sie sich in ihrer Jahreszählung seit ihrer Flucht von zu Hause um rund 300 Jahre geirrt hätten; auch die Lexika verorten diese Flucht mal in das 7. und mal in das 10. Jahrhundert (Topper 3/ 94). Hier präsentierten sich die postulierten 300 Phantomjahre unmittelbar.
Die jüdische Geschichte im christlichen Europa zeigt Dunkelzonen und Diskontinuitäten, die auch dort als "dark ages" geführt werden. Wir zitieren den Fachmann, der zwingend von der Existenz von Juden im damaligen Europa ausgeht: "Trotzdem gibt es keine Zeugnisse, ja nur geringe Wahrscheinlichkeit dafür, daß eine größere Anzahl von Juden irgendwo in der westlichen Welt zu dieser Zeit lebte" (Roth 1966:4). Mit anderen Worten: Zwischen dem 6. Jahrhundert und dem beginnenden 10. Jahrhundert finden sich keine jüdischen Spuren in Europa. Sie werden durch Interpolation zwischen Spätantike und hohem Mittelalter ersetzt (lllig 5/91).
Die Byzantinisten bewegt eine Forschungsfrage ganz besonders, die genau diesen Zeitraum betrifft: Wann wurde die große Verwaltungsreform (Themenreform) durchgeführt, wann und wie entwickelte sich der Feudalismus? Eine Gruppe kommt zum Ergebnis, daß sich alle wesentlichen Details vor 600 ausbildeten und daß in den folgenden 300 Jahren eigentlich nichts passierte. Die andere Gruppe postuliert (‘interpoliert’) zwischen 600 und 900 einen so langsamen Wandel der Gesellschaft, daß er den Akteuren selber kaum ins Bewußtsein kam. Beiden Forschergruppen fehlen für die fraglichen Jahrhunderte Quellen und archäologische Befunde, so daß sie ihre allzu lange "Kontinuitätsdebatte" ‘freischwebend’ führen müssen (Karayannopulos 1959:15; Niemitz 1/94)
.
Auch in Deutschland fehlen archäologische Funde für genau diese Zeit. Zwar fanden die Archäologen in Frankfurt/Main eine wunderschöne, ungestörte Schichtenfolge, die Römerzeiten mit Renaissancezeiten verband; nur die Schichten für die Zeit von 650 bis 910 fehlten. Aber da nicht sein kann, was nicht sein darf, ‘meisterten’ die Archäologen diese Schwierigkeit, indem diese fehlenden Schichten durch abseitige Abfallgruben ersetzt wurden. Deren zahlreiche Scherben verteilten sie über die "Phantomzeit", um der Chronologie zu entsprechen (Stamm 1962; Niemitz 3/93).
Leider stellen auch die Naturwissenschaften keine unfehlbaren Datierungsmethoden bereit. Die allgemein bekannte Radiokarbonmethode (C14-Methode) hängt für den uns interessierenden Zeitraum völlig von der Dendrochronologie ab (Willkomm 1988:176). Diese vergleicht die Muster von Jahresringen in Hölzern. Da ähnliche Ringfolgen zur gleichen Zeit gewachsen sein müssen, versucht sie sich mit zeitlich überlappenden Ringfolgen von Holzprobe zu Holzprobe datierenderweise in die Vergangenheit zurückzuhangeln. Als die Dendrochronologen vor rund 25 Jahren die Jahrtausendwende überschritten und das frühe Mittelalter anschließen wollten, hatten sie extreme Schwierigkeiten, passende Hölzer zu finden. Und wenn sie welche gefunden hatten, dann wollten die Datierungen nicht ins chronologische Schema passen. Es dauerte rund ein Jahrzehnt, bis sich die Dendrochronologen und Historiker im ‘freien Diskurs’ geeinigt hatten; sie opferten dabei die bis dato benutzte dendrochronologische Methode. Aus einer optischen Priifung war ein statistisches Verfahren geworden, dessen hochkomplizierte Korrekturrechnungen nur noch dem Spezialisten zugänglich sind. Trotzdem ließ sich zeigen, daß signifikante Fehler gemacht wurden, um der herrschenden Chronologie zu genügen (Niemitz 3/95).
Sechstens Aachen
Anhand unseres sechsten Beispiels soll ausführlicher demonstriert werden, wie eines der wichtigsten unter den relativ wenigen Zeugnissen des frühen Mittelalters nach allen Regeln der Kunstgeschichte neu datiert werden kann.
Um die wichtigsten Anachronismen der Aachener Pfalzkapelle zu verstehen, greifen wir aus der europäischen Architekturgeschichte ein ebenso markantes wie stabiles Element heraus: den Bau von Gewölben (Illig 1994: 198–281)
.
So wie Rom nicht an einem Tag erbaut worden ist, so konnte auch die Kunst der Wölbung nicht von heute auf morgen perfektioniert werden. Der Weg bis zum 48 Meter hohen gotischen Chor von Beauvais, dem kühnsten Kirchenbau des Mittelalters, war schwierig und von manchen Rückschlägen begleitet. Dieser himmelstürmende Drang, als Ausdruck der faustischen Seele des Abendlandes empfunden, setzte gegen das Jahr 1000 ein. Seit damals wuchsen Türme, Vierungskuppeln und Gewölbe immer höher, obwohl zunächst nur romanische Rundbogen, Mauermassen und selten genug Gewölberippen zu Gebote standen. Dementsprechend dürftig waren die Anfänge
.
In Katalonien, im südlichen Frankreich und auch in Burgund versuchte man sich ab etwa 970 in kleinen und bescheidenen Kirchen mit ebenso bescheidenen Gewölben. Es ging um Spannweiten von kaum 3,50m. Und nur solch kleine Kirchen -etwa die Pyrenäenbauten St.-Michel de Cuxa und St.-Martin-du-Canigou- wurden zur Gänze eingewölbt. Noch St. Philibert in Tournus (zirka 1015) wird dafür gefeiert, daß wenigstens seine Vorkirche vollständig eingewölbt werden konnte. Zwischen 1030 und 1060 gelang es erstmals, große Raumteile zu wölben: Im Dom zu Speyer erhielten die beiden Seitenschiffe -70 m lang und 7,75 m breit- einfache Kreuzgratgewölbe. Erst zwischen 1082 und 1106 gelang es dann -wieder in Speyer-, auch Mittelschiff und Querschiff einzuwölben, also Spannweiten von 14 und sogar 15,40 m, dazu eine Scheitelhöhe von 33 m zu beherrschen. Dazu mußten mächtige Holzbalken die Wände zusammenbinden. Dieselbe Ankertechnik sicherte Querschiffe und Vierungsturm. So konnten die Baumeister in Speyer ein unregelmäßiges Oktogon wagen, das in 50 m Höhe bis zu 15,40 m spannt. Allenfalls in Cluny hat die Romanik mächtiger gebaut.
So führt ein in zahllosen Details belegter Evolutionsweg bei den Kirchenschiffen innerhalb von 140 Jahren von ängstlichen Anfangen bis zu erhabenen Dimensionen: Die Spannweite wächst von gut 3 m auf das Fünffache, die Gewölbehöhe steigert sich von 4 m auf rund das Achtfache. Man muß keiner Dombauhütte angehören, um zu verstehen, daß dafür Steinbearbeitung, Steinschnitt, Statik, Schubableitung und Ankertechnik ständig verbessert werden mußten. Diese bautechnische Entwicklung ist genauso gut belegt wie die ästhetische Entwicklung innerhalb der Romanik.
220 km nordwestlich vom Dom zu Speyer treffen wir auf einen Bau, der dazu in direkte Konkurrenz treten kann: die Aachener Pfalzkapelle. Ihr Zentralbau ist bislang zweifelsfrei Karl dem Großen und der Zeit kurz vor 800 zugeschrieben worden. Sein 30 m hohes Oktogon zeigt im Emporengeschoß, wie man Mauern in ein filigranes Säulengitter auflösen kann. Es wird von einer Kuppel überspannt, die zwischen 14,50 und 15,60 m spannt.Diese mächtige Kuppel braucht Unterstützung. Deshalb wird sie nicht nur von einem Eisenkorsett zusammengeschnürt, sondern von Strebepfeilern und dem doppelstöckigen Umgang gestützt. In diesem Umgang sind Wölbungsprobleme mit erstaunlicher Meisterschaft gelöst. Für sein Erdgeschoß wählte man keineswegs eine simple Tonne oder ein schlichtes Kreuzgratgewölbe. Nein, man baute eine wabenförmige Struktur, die in bestem Steinschnitt zwischen innerem Achteck und äußerem Sechzehneck vermittelt. Die Emporenlösung ist beinahe noch raffinierter. Sechzehn Mauern steigen zum Oktogon hin an und stützen es. Paarweise werden sie von ebenfalls ansteigenden Tonnengewölben verbunden, die gleichfalls den Schub ableiten. In den Zwickeln zwischen den acht Tonnen finden wir dreieckige Stichkappen, über den Wendeltreppen Schneckengewölbe. So läßt sich mit Fug und Recht behaupten, daß der zuständige Baumeister das ganze Repertoire an romanischen Wölbtechniken virtuos eingesetzt hat.
Aber konnte er um 800 bereits romanische Techniken kennen? Konnte er auch nur eine Wölbungsart kennen? Wenn wir die oben skizzierte, bestens belegte Evolutionslinie zwischen 970 und 1110 ernst nehmen, dann konnte er überhaupt noch nicht wölben. Warum also trotzdem ein Oktogongewölbe in Aachen, das ebenso weit spannt wie das von Speyer und ebenso hoch reicht wie dessen Mittelschiff? Nachdem handwerkliche Tradition nicht vom Himmel fällt, sondern mühsam genug erworben wird, müssen wir feststellen, daß Aachen außerhalb der abendländischen Entwicklung zu stehen scheint. Ganz egal, ob wir Wölbtechnik, Steinschnitt, Ankertechnik, Mauerauflösung betrachten - immer liegt Aachen 200 bis 300 Jahre in Front. Das gilt für mehr als ein weiteres Dutzend Bauelemente. Ob Strebesystem oder Vertikalität, Wandgliederung oder gebundenes System, Turmbau oder Westwerk, Säulengitter oder Bronzeguß, nicht zuletzt die Formprinzipien Doppelkapelle und Oktogon - all diese Merkmale sind der Romanik wohlbekannt, leiten sich aber nicht direkt von Aachen her, sondern werden Jahrhunderte später noch einmal erfunden, um erst dann an der Bauevolution der Romanik teilzunehmen.
Es bliebe als Ausweg, Aachen als spätesten Vertreter antiker Baukunst einzustufen. Das versuchten die Architekturhistoriker auch; aber es ist beim Versuch geblieben. Zwei ‘Genealogien’ wären möglich. San Vitale in Ravenna vermittelt einen vergleichbaren Raumeindruck wie das fast 300 Jahre spätere Aachen. Aber bautechnisch stammt Aachen niemals von byzantinischen Vorbildern ab. Denn bei diesen wurden die Wölbungen so leicht wie möglich ausgeführt: mit Ziegeln und hohlen Tonelementen wie Amphoren oder Tonröhren. Dank dieser Gewichtsreduktion blieben die Schubkräfte beherrschbar, selbst bei der Riesenwölbung der Hagia Sophia, die wie San Vitale unter Kaiser Justinian (527–565) erbaut worden ist. Aachens Oktogon wird dagegen von massivem Stein überwölbt, der noch an der schwächsten Stelle 81 cm mißt -eine in Byzanz nie versuchte Aufgabe. Aachen könnte aber auch vom kaiserlichen Rom abstammen. Hat Karl der Große Anleihen bei den alten Römern gemacht, etwa bei Pantheon oder Konstantinsbasilika? Auch das kann zuverlässig verneint werden. Denn die damaligen Römer gossen Betonkuppeln aus zementähnlicher Pozzulanerde und leichtesten, vulkanischen Zuschlagstoffen. Derartige Kuppeln entwickeln kaum Schubkräfte, wie mit einer umgedrehten Kaffeetasse auf vier Bauklötzchen leicht demonstriert werden kann.
Baugeschichtlich hat das Aachener Oktogon also keine Vorläufer. Sollen wir an das Wunder glauben, daß die Bauhütte zu Aachen, die ja selber auch mindestens zwei Jahrhunderte zu früh käme, ad hoc meisterliche Lösungen für alle Gewölbeprobleme gefunden hätte? Binnen zehn Baujahren ein Entwicklungssprung anstelle einer Evolution, die in der Romanik 140 Jahre gedauert hat? Und warum brauchte es diese Evolution, wenn schon alles erfunden war? Die Aachener Pfalzkapelle, ein vollendeter Bau ohne Vorläufer, ohne direkte Nachfolger, außerhalb jeder Bautradition, ein erratischer Block in der abendländischen Baugeschichte.
Aber auch dieser gordische Knoten kann zerschlagen werden. Wir hinterfragen ganz einfach Aachens Datierung. Das ist bislang nie geschehen, weil ja Karl der Große als Bauherr feststand. Erkennt man diesen Kaiser als eine der gelungensten Fiktionen der drei "Phantom-Jahrhunderte" (Illig 1994), dann erlauben die bisherigen Anachronismen der Pfalzkapelle eine sehr genaue Datierung innerhalb der romanischen Evolution. Alle Widersprüche lösen sich, wenn dieser Bau in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts entstanden ist, in engster zeitlicher Nähe zum Dom von Speyer. Selbstverständlich bricht schon damit die vertraute Geschichte des frühen Mittelalters zusammen. Denn wenn diese Pfalzkapelle erst gegen 1100 fertiggestellt wurde, dann verliert die zentrale Pfalz des Karolingerreichs ihren Kern. Wenn allenfalls spärliche Baureste übrigbleiben, die der Zeit um 800 zugeschrieben werden könnten, dann fehlt dem großen Karl die königlich-kaiserliche Kirche, dann fehlt noch eine ganze Zeitlang die Krönungskirche fränkischer Herrscher, dann verschwindet die Ansiedlung Aachen als Zentrum eines Frankenreiches. Mit nur geringer Übertreibung läßt sich sagen: Ohne Aachens Pfalzkapelle ist kein fränkischer Staat zu machen.
Einstige Überlieferung und heutiger Baubefund stehen hier in krassem Widerspruch, der sich nur durch eine Umdatierung beseitigen läßt. Aus diesem Beispiel, das für viele ähnliche Befunde steht, haben wir drei Erkenntnisse gewonnen:
* Das frühe Mittelalter kann niemals so gewesen sein, wie es die Lehrbücher darstellen.
* Die mannigfaltigen Schwierigkeiten lassen sich dadurch beheben, daß man eine gewisse Zeit als künstliche Phantomzeit erkennt, die zwischen realen Jahrhunderten steht.
* Viele Indizien deuten im Abendland auf einen zusammenhängenden Abschnitt von fast genau 300 Phantomjahren hin, der das 7., 8. und 9. Jahrhundert umfaßt.
Kam diese Phantomzeit zufällig oder beabsichtigt in unsere Geschichte? Gegen reinen Zufall spricht, daß ein solcher längst hätte bemerkt werden müssen. Bei einer absichtlichen Verfälschung des Kalenders sollten sich jedoch Indizien und vor allem Motive finden lassen. Wir zeigen zwei religiöse Motive für Geschichtsfälschung, die sich ergänzen, aber auch unabhängig voneinander gewirkt haben können.
Der Byzantinistik sind zwei unverstandene Vorgänge bekannt. Ab 835 sind alle in griechischer Majuskel abgefaßten Texte nach und nach in die neue Minuskel umgeschrieben, die Originale aber vernichtet worden (Schreiner 1991:13). So ist das gesamte Schriftgut der damals führenden Kulturnation binnen ein, zwei Generationen komplett neu geschrieben worden, und niemand weiß, ob hier nur sorgfältig abgeschrieben oder auch neu geschrieben worden ist. Daraufhin hat Kaiser Konstantin VII. Porphyrogennetos (911–959) viele antike Schriften in Auswahl kopieren und zusammenfassen lassen. Diese Exzerpte sind heute unser einziger Zugang zu vielen antiken Texten. Da in einem phantomzeitlichen 9. Jahrhundert keine Umschreibung stattgefunden haben kann, würden beide Aktionen auf Konstantin VII. zurückgehen, der schließlich auch die byzantinische Geschichte der letzten 300 Jahre neu schreiben ließ, ja zum Teil selbst verfaßte. Dieser Kaiser hatte eine sehr christliche Motivation für die vielleicht gewichtigste Zensuraktion des Abendlandes. 614 raubten die heidnischen Perser die erhabenste Reliquie der Christenheit, das Kreuzesholz. Seine tradierte Rückeroberung wirkt so obskur (ein Engel entwirft dem Kaiser den überaus riskanten Schlachtplan), daß sie eine andere Wahrheit zu verdecken scheint: Byzanz und die Christenheit wollten Jahrhunderte Abstand zu diesem Skandalon. In dieser fiktiven Zeit wäre das Kreuzesholz zumindest fiktiv rückgewonnen, in tausend Partikeln übers Abendland verteilt und so die unsägliche Schmach getilgt worden (Illig 4/ 92b).
Mit dieser ‘Distanzierung’ hätte Kaiser Konstantin das gesamte Abendland vordatiert. Und so regierte dann Kaiser Otto III. in dem ominösen Jahr 1000. Otto und der von ihm eingesetzte Papst Silvester II. legten aus eschatologischen Gründen -tausend Jahre sind wie ein Tag- größten Wert auf diese Jahrtausendwende. Mit ihr konnten beide das Zeitalter Christi auf Erden als seine Stellvertreter eröffnen. Wir wollen zum jetzigen Zeitpunkt nicht die Möglichkeit ausschließen, daß Otto und Silvester selbst das Rad der Geschichte um drei Jahrhunderte vorgedreht haben, um das Jubeljahr zu erleben. Die politische Situation im ausgehenden 10. Jahrhundert war auf alle Fälle selten günstig. Ottos Mutter Theophanu war mit dem byzantinischen Kaiser Johannes 1. Tzimiskes (969–976) verwandt, der aus derselben Makedonischen Dynastie stammte wie Konstantin VII. Und Otto III. arbeitete mit dem Papst Hand in Hand -einmalige Eintracht zwischen Byzanz, Rom und dem Kaiser im Westen (Illig 3/91)!
Dieses Vordrehen des Kalenders, ob durch Konstantin oder Otto, erzeugte 300 leere Jahre. Sie zu füllen, gab vielen die Möglichkeit, 300 Jahre ‘gelebter’ Geschichte nach eigenem Gusto zu erfinden. Für Kaiser wie Papst war es vorteilhaft, die anzustrebende Zukunft als schon einmal gewesene Vergangenheit auszumalen, mangelnde Autorität durch Rückgriffe auf übermächtige Ahnen zu ersetzen. So kreierten sie einen Karl den Großen, dessen Reich all das umfaßte, was Otto III. anstrebte. Die erste Skizzierung malten spätere Generationen von Kaisern, Königen, Päpsten, Mönchen und Historikern zu einem immer prächtigeren Bild aus. Die Fälscherenkel, wie Heinrich IV., Friedrich Barbarossa oder Friedrich II., konnten nicht ahnen, daß dereinst Geschlechter auftreten würden, die lieber im Boden wühlen, als sich durch schöne Geschichten beeindrucken zu lassen.
Wir lassen hier den Vorhang fallen und alle Fragen offen, um einem berühmt-berüchtigten Vorbild zu folgen. Was immer weitere Forschung ans Licht bringen wird - für das frühe Mittelalter steht ein Paradigmenwechsel an, der uns zu neuen Erklärungen der eigenen Vergangenheit führen wird.
Allgemeine Literatur
Horst Fuhrmann: Von der Wahrheit der Fälscher. Monumenta GermaniaeHistorica Band 33 Fälschungen im Mittelalter Internalionaler Kongreß der Monumenta Germaniae Historica München 16.-19. September 1986 Teil 1:83–98
E. Hollstein: Dendrochronologische Untersuchungen an Hölzern des frühen Mittelalters. Acta Praehistorica 1(1970):147–156
E. Hollstein Mitteleuropäische Eichenchronologie. 1980
Johannes Karayannopulos: Die Entstehung der byzantinischen Themenordnung. Beck München 1959
Cecil Roth / I.H. Levine (Hrsg.): The Dark Ages. Jews in Christian Europe 711–1096. Band 11 der World History of the Jewish People, London 1966
Peter Schreiner: Die byzantinische Geisteswelt vom 9. bis zum 11. Jahrhundert. In: Anton von Euw; Peter Schreiner (Hrsg.): Kaiserin Theophanu. Begegnung des Ostens und Westens um die Wende des ersten Jahrtausends. Gedenkschrift des Kölner Schnütgen-Museums zum 1000. Todesjahr der Kaiserin. Band 11 Köln 1991
Otto Stamm: Spätrömische und frühmittelalterliche Keramik der Altstadt Frankfurt (Schriften des Frankfurter Museums für Vor- und Frühgeschichte). Frankfurt/Main 1962; Horst Willkomm: Kalibrierung von Radiokarbondaten.Acta Praehistorica 20 (1988): 173-181
Literatur zur Phantomzeit
Heribert Illig, Hat Karl der Große je gelebt? Bauten, Funde und Schriften im Widerstreit. Mantis, Gräfelfing 1994
Die nachfolgenden und weitere Artikel erschienen in Vorzeit-Frühzeit-Gegenwart - Interdisziplinäres Bulletin, seit 1995 unter dem neuen Titel Zeitensprünge im Mantis Verlag, Dr. Heribert Illig, D-82166 Gräfelfing, Lenbachstraße 2a. Sie sind zwischen 5 und 23 Seiten lang; 1/91 bedeutet zum Beispiel: Heft 1 aus den Jahr 1991.
Heribert Illig (l/91), Die christliche Zeitrechnung ist zu lang
–(3/91), Vater einen neuen Zeitrechnung: Otto 111 und Silvester 11.
–(5/91), Jüdische Chronologie. Dunkelzonen, Diskontinuitäten, Entstehungsgeschichte
–(4/92a), 614/911 - der direkte Übergang vom 7. ins 10. Jahrhundert
–(4/92b), Vom Erzfälscher Konstantin VII. Eine "beglaubigte" Fälschungsaktion und ihre Folgen
Illig /Niemitz (1/91), Hat das dunkle Mittelalter nie existiert?
Hans-Ulrich Niemitz (1/91), Fälschungen im Mittelalter
–(3 4/93), Eine frühmittelalterliche Phantomzeit - nachgewiesen in Frankfurter Stratigraphien
–(1/94), Byzantinistik und Phantomzeit
–(3/95), Die "magic dates" und "secret procedures" der Dendrochronologie
Uwe Topper (3/94), Zur Chronologie der islamischen Randgebiete. Drei Betrachtungen
Kalender mit beschränkter Haftung. (2. Teil)
Frühmittelalterliche Phantomzeit auf schwebenden Fundamenten. Von heribert Illig
Den Vorhang zu zu und alle Fragen offen? So verabschiedete sich der Verfasser zwar in seinem Artikel in der GEGENWART 28, aber SO einfach gab sich die Leserschaft damit nicht zufrieden. Die Redaktion bekam einen ganzen Sack voller Fragen, Zweifel und Kritiken in den Flur gestellt. Am häufigsten tauchte darin die Frage auf, wie sich ein um fast 300 Jahre gekürztes europäisches Mittelalter mit der Zeitrechnung anderer Länder und Völker vertragen solle.
Bevor wir uns der Synchronisierung "ringsum" widmen, wird die These noch einmal knapp wiederholt: Etliche Jahrhunderte des frühen Mittelalters bezeichnen die historischen Wissenschaften mit dem Attribut "dunkel". Damit wird kein moralischer Verfall angesprochen, sondern die Tatsache, daß uns von diesen Jahrhunderten beunruhigend wenig bekannt ist. Weder gibt es greifbare Hinterlassenschaften in einer Menge, wie man sie mit Fug und Recht erwarten dürfte, noch existieren ausreichende zeitgenössische Quellen und Berichte. Zu allem Überdruß stammen diese wenigen Quellen häufig gar nicht aus diesen Zeiten selbst. sondern sind erst (viel) später geschrieben worden. Obwohl nun die Historiker seit zwei Jahrhunderten versuchen, diese Dunkelzeiten zu erhellen, verbleiben weite Bereiche in sehr tristem Dämmerlicht.
Der Verfasser löst dieses Dilemma und viele immanenten Widersprüche mit der provokanten These, daß ein ganzes Zeitalter niemals stattgefunden hat. nämlich die Zeit zwischen 614 und 911. Diese Phantomzeit ist erst später zwischen reale Zeiten eingeschoben worden, weshalb sie zwangsläufig keine realen Zeugnisse hinterlassen hahen kann. Wenn ihr gleichwohl Artefakte zugeschrieben werden, dann sind diese aus anderen Zeiten eingeschleust worden und müssen an diese wieder zurückgegeben werden. Das ist beispielgebend an dem berühmtesten Bauwerk des frühen Mittelalters, der Aachener Pfalzkapelle, gezeigt worden: Wegen zahlreicher anachronistischer Bauteile kann sie niemals einem 8. Jahrhundert entstammen und niemals von einem Karl dem Großen gebaut worden sein. Historische Gestalten dieser drei Phantom-Jahrhunderte sind entweder spätere Erfindungen– wie Karl der Große–oder wurden in diese Zeit verpflanzt, wie etwa die Werke des allzu frühen Scholastikers Duns Scotus Eriugena oder des allzu frühen Historikers Beda Venerabilis. der uns hier gleich beschäftigen wird. So wurden–unter Hilfestellung inshesondere von Hans-Ulrich Niemitz, Uwe Topper und Manfred Zeller– diese drei Jahrhunderte "ausgekehrt" oder "evakuiert", worauf die Zeit vor 615 direkt in die Zeit nach 910 übergeht.
Es wurde auch geschildert, daß mit Kaiser Konstantin VII. und dem Duo Kaiser Otto III. und Papst Silvester II. Protagonisten gefunden sind, die zweierlei veranlassen konnten: das Vordrehen der Uhr um 300 Jahre und das anschließende Füllen derfrisch geschaffenen Lücke nach eigenen Wünschen. So ist Karl der Große sicher von Otto Ill. kreiert worden, der einen Renommierahnen erster Güte wollte. Die Streitigkeiten zwischen Kaisern und Päpsten des 11. bis 13. Jahrhunderts– Stichwort Jnvestiturstreit–führten dazu, daß dieser Popanz in immer prächtigeren Farben ausgemalt wurde, um schließlich von Friedrich Barbarossa unter die Heiligen eingereiht zu werden.
Ein Kaiser als Lückenbüßer, ein anderer Kaiser als Lückenreißer- all das geschah nicht im luftleeren Raum, sondern in einem Europa, das innerhalb der Alten Welt keineswegs eine Isolierstation bildete. Es führte–wie gewohnt–Kriege mit seinen Nachbarn, damals vor allem mit den Arabern, und hatte Handelsbeziehungen bis zum afghanischen Hindukusch, dessen Lapislazuli aus irischen Handschriften leuchten. Weil auch im Süden und Osten Zeitrechnung betrieben wurde, sollte es hier möglich sein, eine derartige Phantomzeit zu bestätigen oder zu widerlegen. Bevor wir die dortigen Epochenrechnungen prüfen, lassen wir Licht auf die uns allen vertraute christliche Zeitrechnung fallen.
Die Zeitrechnung "nach Christi Geburt"
Die Frage, wann sie eingeführt wurde, ist leichter gestellt als beantwortet. Ein Mönch namens Dionysius Exiguus datierte im Jahre 525 seine Osterterminberechnungen als erster "nach Christi Geburt", weil ihn gestört haben soll, daß er mit der damals üblichen Diokletiansära (oderMärtyrerära) ausgerechnet einem Christenverfolger die Ehre gäbe. Aber dieser Wechsel des Bezugspunktes beeindruckte in seinem Jahrhundert keinen Menschen. Niemand benutzte seine neue "Epoche", wie der Startpunkt einer Zeitrechnung von den Spezialisten bezeichnet wird.
Erst Beda Venerabilis, ein englischer Benediktiner (ca. 672–735). benutzte diese Datierungsmethode in seiner Kirchengeschichte des englischen Volkes und gebrauchte sie erstmals auch für Ereignisse vor Christi Geburt, doch das war anno 731 und damit zwei Jahrhunderte später. An ihm orientierten sich die karolingischen Chronisten und Notare, so daß wir in Urkunden des 8. und 9. Jahrhunderts öfters auf Daten n. Chr. stoßen. Im 10. Jh. läßt die Lust daran deutlich nach, um sich erst zur und vor allem nach der Jahrtausendwende über Europa zu verbreiten. So weit reicht das herrschende Wissen.
Nun wurde Beda von dem Astronomen Robert R. Newton 1972 dabei ertappt, daß er in einem seiner Werke die Null benutzt hat. Beda selbst empfand den Gebrauch der Null nicht als sensationell. denn er schrieb so, als ob er die Kenntnis dieser speziellen Zahl und Ziffer bei seinen Lesern voraussetzen könne. Nun ist die indische Null aber erst Ende des 11. oder Anfang des 12. Jahrhunderts über das maurische Spanien nach Europagelangt. um 1203 Eingang in die Lehrbücher zu finden (liber abaci von Fibonacci). Waren Beda und sein Leserzirkel den übrigen Europäern um 400 oder noch mehr Jahre voraus?
In der herrschenden Historie konnte Newtons Problem in den letzten 24 Jahren nicht beantwortet werden. Stimmt meine These, kann Beda nicht im 7.8. Jahrhundert gelebt haben, da es diese Zeit ohnehin nicht gegeben hat. Deshalb muß Beda in eine andere, reale Zeit verbracht werden, am besten in eine, die seinem Wissen entspricht. Die Verwendung der Null verlangt das 12. Jahrhundert. Dazu paßt Bedas Einschätzung durch Olaf Petersen, daß ."kein wissenschaftliches Werk vergleichbaren Wertes in der lateinisch schreibenden Welt vor Beginn des 13. Jahrhunderts erschienen ist". So können wir sinnstiftend postulieren, daß die unter Bedas Namen kursierenden Schriften in Wahrheit aus dem 12. Jahrhundert stammen.
Die ebenfalls "nach Christi" datierten "karolingischen" Urkunden müssen nicht mehr von Beda beeinflußt sein, können aber mit Fug und Recht erst aus der Zeit nach 1000 stammen, als diese Datierungsart sich verbreitet hat.
Damit gewinnen wir eine Erklärung für einen ansonsten nicht leicht verständlichen Vorgang. Wer meine Theorie prüft, muß fragen, wie ein Kaiser Otto III. die Uhr um 300 Jahre vordrehen konnte, ohne daß irgend jemand den heilsgeschichtlichen Schwindel kritisch kommentiert hätte. Wenn Otto beim Vordatieren den Bezugspunkt, dieEpoche gewechselt hat, dann war dieserEpochenwechsel–imdoppelten Sinne des Wortes–nur noch für ausgesprochene Spezialisten erkennbar. Diese wenigen Kenner waren allesamt in der Geistlichkeit beheimatet, die das Monopol auf Schriftkenntnis hatte und ohnehin Träger dieser Umdatieraktion gewesen sein muß.
Mit dieser Annahme löst sich ein weiteres Problem. Noch immer sind sich die Historiker uneins, ob das Nahen der Jahrtausendwende für die Christenheit Anlaß für eine wilde Massenhysterie oder ein eher gleichgültiges Ereignis war. Lange Zeit imaginierten sie eine in Panik versetzte Menschheit, der Weltensturz und Höllenrachen vor schreckgeweiteten Augen flimmern. Doch Jose Ortega y Gasset hat schon1904 nachgewiesen, daß "die Legende über das Jahr eintausend vollständig unwahr ist"–aber diese seine Dissertation wurde bezeichnenderweise ers 1992 gedruckt. Allzu "natürlich" er schien es fast allen Historikern, daß zu runden Jahreszahlen hysterische Reaktion ausbrechen, als daß man sich von nüchtemer Betrachtung leiten lassen wollte.
Nunmehr können wir vermuten, daß der christozentrisch denkende Otto III. das heilsgeschichtlich bedeutsame zweite Jahrtausend einläutete, indem er Bezug auf Christi Geburt nahm, was vor ihm nur ein "dürftiger (=exiguus)" Dionysius tat. So hatte das Volk gar nicht die Zeit, vor der Jahrtausendwende zu zittern. Das Zagen setzte erst danach ein, als man –jäh in endzeitliche Gefilde versetzt– apokalyptische Geschehnisse, das Auftreten des Antichrist und das Jüngste Gericht befürchten mußte. So setzen bald nach der Jahrtausendwende Hysterien, Irrlehren und Ketzerverfolgungen ein.
Otto III. konnte also durch den Wechsel der Epoche kaschieren, daß er die Uhr vom Jahr 703 ins Jahr 1000 vordrehte. Noch bessere Kamouflage versprach, den 297-Jahres-Sprung nicht in die eigene Gegenwart zu legen, sondern früher anzusiedeln, am besten noch vor Großvater Otto I. Dann bildeten die letzten 90 Jahre, die ohne schriftliche Fixierung gerade noch von den Lebenden erinnert werden, ein korrektes Kontinuum. Um dieses Kontinuum belegen zu können, mußten Urkunden der nun zum 10. Jahrhundert erklärten Zeit vom 7. in dieses l0. Jahrhundert umdatiert werden. Genau dieser Vorgang ist längst bekannt, aber bislang nicht verstanden worden. Denn viele Urkunden des 10. Jahrhunderts weisen nachträglich veränderte Datumzeilen auf. Dabei sind so haarsträubende Fehler passiert, daß die Urkundenkenner sich wundern. wie kaiserliche Notare
vergessen konnten, in welchem Jahr sie eigentlich schrieben. Eine spätere Umdatierung zahlreicher Urkunden läßt gerade solche Fehler erwarten.
Byzantinische Weltära
Wenn wir uns nun anderen. gleichzeitigen Zeitrechnungssystemen zuwenden, dann stoßen wir auf ganz ähnliche Begleiterscheinungen. So hat auch das zweite, noch mächtigere Kaiserhaus Europas justament in den dunklen Jahrhunderten seine Epochenrechnung verändert. Nachdem es die Hauptstadt von Rom an den Bosporus verlegt hatte, mußte früher oder später auch der Wunsch keimen, nicht mehr nach der Gründung Roms (-753) zu datieren, eine keineswegs uralte Methode, sondern erst nach Cäsars Kalenderreform durch Varro eingeführt. Der Bezug auf Roms Gründung ließ sich von Byzanz am besten dadurch übertrumpfen, daß man so weit zurückging, wie irgend möglich, am besten also gleich bis zur Erschaffung der Welt.
Genau so ist man vorgegangen, und es traten Phänomene auf, die uns bereits vertraut sind. Denn die Alexandrinische Weltärarechnung ist von Panodoros und dann Anianos bereits vor 412 n. Chr. erfunden worden, indem sie beschlossen, daß die Erschaffung der Welt rund 5 5.900 Jahre zurückliege. Als neue Epoche (Startdatum) wählten sie –umgerechnet– den 25. 3.5493 v. Chr. Panodoros' Zeitgenossen hat das nicht weiter bewegt. und so kam diese alexandrinische Weltära bei den byzantinischen Geschichtsschreibern erst ab dem 7. Jahrhundert an stärker in Gebrauch. Diese Auskunft durch Altmeister Ginzel hat ihre Schwächen, kennen wir doch keinen byzantinischen Geschichtsschreiber des 7. Jahrhunderts. Denn gegen 6l0 scheinen die Kaiser demütig geworden zu sein: Sie verzichteten auf ihren Hofgeschichtsschreiber und damit auf ihren Nachruhm, obwohl ihnen Kaiser Justinian im 6. Jahrhundert mit Prokop ein überzeugendes Vorbild geliefert hatte. Auch übergreifende Historien waren nicht mehr gewünscht, so daß deren Tradition mit ein oder zwei kümmerlichen Ausnahmen erst im 10. Jahrhundert wieder aufgenommen wurde. Diese seltsame Bescheidenheit auf dem byzantinischen Thron wird erstmals durch die These der Phantomzeit verständlich: Hier wurden erst rückwirkend Leerzeiten mit Geschichte gefüllt.
Das stolze Byzanz gab sich mit einer Datierungsmethode nicht zufrieden, sondern bekam auch noch eine spezielle Byzantinische Ära. Ihr Startdatum lag auf dem 1. 9. 5509 v. Chr., griff also noch 16 Jahre weiter zurück. Erstmals benutzt wurde sie laut Ginzel im Jahre 691 n. Chr., doch sie verbreitete sich keineswegs zügig, das heißt ihre Benutzung im 7., 8., und 9. Jahrhundert ist kaum nachzuweisen. Erst im 10. Jahrhundert erhielt sie den Vorzug vor der etwas kürzeren Altemativrechnung und blieb dann bis zum Untergang von Byzanz im Gebrauch.
Wir finden also dasselbe Phänomen wie im Westen: Neue Bezugspunkte für die Zeitbestimmung werden definiert, aber zunächst kaum oder gar nicht benutzt. Die faktische Durchsetzung ist schwer datierbar. Gravierend ist hier: Obwohl die Reihe der römisch-byzantinischen Kaiser kontinuierlich von Augustus bis Konstantin XII., von -30 bis + l453 reicht, läuft die Zeitrechnung nicht kontinuierlich, sondern wird gleich zweimal umgestellt, wobei die Umstellungen in dunkle Zeiten fallen. Offenbar sollte hier genauso wie im Westen etwas verschleiert werden.
Jüdische Zeitrechnung
Es bleibt uns noch eine Zeitrechnung, die weiterhelfen könnte. Jüdische Gelehrsamkeit hat seit Abfassung der Genesis unentwegt Geschichtsschreibung betrieben, immer auf Schriftlichkeit gesetzt. So glaubten wir zu wissen –tatsächlich aber finden wir im frühen Mittelalter ein konträres Phänomen. Nachdem der babylonische Talmud im 6. Jahrhundert seine Endredaktion erfahren hatte, setzte keineswegs die Auseinandersetzung mit diesem Werk ein, erschien keine Flut von weiteren Kommentaren und Disputen. Statt dessen verzichteten die Juden für mehrere Jahrhunderte auf das Schreiben. Ausgerechnet die große Zeit der Schriftgelehrten, die Zeit der Gaonim, muß ohne Werke auskommen. Nur aus späteren Zeiten wird das eine oder andere Zitat tradiert.
Der Begriff der Dunklen Jahrhunderte bezieht sich auch bei den Juden auf Textquellen und auf die Fundlage. Jüdisches ist im Europa des 7., 8. und 9. Jahrhundert nicht zu greifen. Zwar saßen Juden schon im 4. Jahrhundert am Rhein, doch eine Kontinuität jüdischen Lebens bis ins 2. Jahrtausend ist nirgends nachweisbar. So werden jüdische Gemeinden erst im 10. Jahrhundert wieder greifbar. Weil nichts über Vertreibungen oder Pogrome bekannt ist, wird Kontinuität gemutmaßt. C. Roth und I. Levine haben ihr einschlägiges Buch The Dark Ages genannt und gleich eingangs festgehalten, daß sie die Zeitumstände in drei Jahrhunderten allein durch Interpolation erhellen konnten. Indem sie die Zeit vor 600 mit der nach 900 verglichen, schlossen sie auf die Zeit dazwischen. Diese rätselhafte Lücke bei Funden und Schriften konnte bislang allenfalls durch langanhaltende Schreibfaulheit motiviert werden– die These der Phantomzeit erklärt diese Dunkelzeiten erstmals befriedigend.
Aber haben die Juden nicht schon immer ab der Weltschöpfung gerechnet? Besitzen wir nicht seit biblischen Zeiten ein Zeitgerüst, das seitdem ständig ausgebaut worden ist und deshalb keine Diskontinuitäten zuläßt? In Wahrheit haben die Juden fast ein Jahrtausend lang nicht nach ihrer Bibel, sondern nach der Seleukidenära gerechnet. Das war die Datierung für Geschäftskontrakte, die eine Schlacht zwischen Diadochen (-312) zur Basis hatte.
Im Jahre 358/59 n. Chr. bezeichnete Rabbi Hillel das Jahr 670 der Seleukidischen Ära als das Jahr 4119 annus mundi (=Jahr der Welt), schuf also vielleicht die erste Jahreszählung ab der Erschaffung der Welt. Doch damit war die Weltära keineswegs eingeführt. Die Jerusalemer Encyclopedia Judaica erachtet Hillels Anteil als ziemlich dunkel und sieht die Ära-Einführung erst um 500 n. Chr. Für die Berliner Encyclopedia Judaica ist die Weltschöpfungsära erst im 8. Jahrhundert eingeführt und erst 921 in ihre endgültige Fassung gebracht worden. Andere glauben, daß sie sich in diesem 10. Jahrhundert auch durchgesetzt habe, während ihr einKenner wieArno Borst überhaupt erst im 12. Jahrhundert Akzeptanz zugesteht.
Mit anderen Worten: Wir haben wieder einen Ära-Einführer, der lange unbeachtet blieb. Seine Idee soll sich im besten Fall nach 600 Jahren, vielleicht noch später durchgesetzt haben. Das erinnert seltsam an Dionysius Exiguus und an Panodoros und belegt, daß auch die Einführung der jüdischen Weltära hinter geschlossenen Vorhängen stattfand.
So gibt es in Europa keine Kalenderrechnung, die kontinuierlich durch die Zeiten läuft. Alle vier Ären, die christliche, die beiden byzantinischen wie die jüdische setzen so ein, daß ihre eigentlichen Anfänge nicht greifbar sind. Die verfügbaren Quellen führen zu so widersprüchlichen Aussagen, daß diese Widersprüche geradezu für die Phantomzeit bürgen.
Im Wissen um drei Jahrhunderte Phantomzeit läßt sich noch eine Spekulation anfügen. Wir haben bereits von der Alexandrinischen Weltära gehört. Es gab nun zwei weitere, fast identisch benannte Ären. Zwölf Jahre vor der Seleukidenära startete die Ära nach dem Tode Alexanders, auch Philippinische Ara benannt. 294 Jahre nach dieser Epoche, anno -30, eroberte der spätere Kaiser Augustus die Weltstadt Alexandria. Der Tag der Einnahme wurde als Epoche der Ära des Augustus definiert, eine Zeitrechnung, die auch Alexandrinische Ära genannt wurde. Wer auch immer einen Zeitsprung plante, fand hier die beste Deckung. Indem er Daten der alexandrinichen Ära in solchen der alexandrischen Ära ausdrückte, drehte er die Geschichtsuhr um 294 Jahre vor. Wenn er dann noch in einer alexandrinischen Welteltära weiterrechnete, war die Verwirrung vollkommen und ein Zeitsprung verdeckt, der den von mir errechneten 297 Jahren auffällig nahe kommt.
China und Indien
Außerhalb Europas verschwimmt alles noch mehr, falls dies im angeblich so überaus präzisen Kalenderwesen noch möglich ist. Immerhin läßt sich festststellen, daß China und der ganze Ferne Osten nicht hinreichend mit der Welt im Westen synchronisiert sind. Vor dem 10. Jahrhundert ist nur eine einzige relevante Berührung mit dem Westen bekannt: 751 sollen in der Schlacht bei Samarkand arabisch geführte Truppen gegen chinesische Verbündete gesiegt haben. Aus diesem schwächlichen Bindeglied –2.100 km von Bagdad, 4.200 km von Peking angesiedelt– kann nicht abgeleitet werden, daß die chinesische Tang-Dynastie (618–907) eine Phantomzeit ist und deswegen ihre staunenswerten Funde abgeben muß. Aber es wird sich auch hier empfehlen, den Kalender kritisch zu prüfen. Möglicherweise resultiert Chinas jahrhundertelanger Vorsprung auf vielen Gebieten schlicht und einfach daher, daß östliche und westliche Historie falsch synchronisiert worden sind.
Das östlichste Gebiet, das im frühen Mittelalter noch mit der abendländischen Geschichte abgestimmt werden kann, ist Indien. Nun stammen aus diesem Subkontinent zwar unsere Ziffern samt der Null und wichtigen Rechenregeln, aber die dortige Kalenderrechnung kann wenig erhellen.
So haben die Versuche, Buddhas Todesdatum festzulegen, nur eine Sicherheit gebracht: Die indischen Zeitrechnungssysteme widersprechen einander allesamt. Schwierigkeiten macht nicht nur der Nachweis von Buddha als historischer Person, sondern vor allem sein Einfügen in die Geschichte. Die "lange Chronologie" des südlichen Buddhismus datiert Buddhas Tod auf -544, die "korrigierte ceylonesische Chronologie" auf -486, die "kurze Chronologie" auf 368 v. Chr.; heutige Berechnungen nennen sogar 290 v. Chr. Diese Daten –tibetische gar nicht beachtet, die Buddha schon im -3. Jtsd. sterben lassen– schwanken in einem Ausmaß, das den Dunklen Jahrhunderten gleichkommt. Die Fundmengen der verschiedenen indischen Epochen lassen die Möglichkeit offen, daß hier bestimmte Zeiträume überdehnt worden sind, um eine Korrelation mit griechisch-hellenistischen Angreifern und Kolonisatoren zu ermöglichen.
Persische und parsische Zeitrechnung
Das sassanidische Persien, lange Zeit der mächtigste Gegner von Byzanz, hat in zwölfter Stunde eine neue Zeitrechnung eingeführt. Ihr letzter König, Yezdegird III., soll den Tag seiner Thronbesteigung 632 zum Beginn einer neuen Zeitrechnung bestimmt haben. Warum hätte sie die arabische Eroberung überdauert, die schon ein Jahr später einsetzt und 641 die Sassaniden stürzt, zumal die Araber doch eine eigene Zeitrechnung mitbrachten? Gleichwohl soll sie jahrhundertelang benutzt worden sein, bis im 11. Jahrhundert Großsultan Dschelaleddin den nach ihm benannten Kalender einführen ließ.
Das Geschehen in Persien ist schwer ausleuchtbar, so daß wir nur zwei Streiflichter auf bislang Unverständliches fallen lassen können. Trotz der frühen arabischen Eroberung von 641 und der sofort einsetzenden Verdrängung des Zoroastrismus ist Persien, zumal sein Osten, im 10. Jahrhundert noch keineswegs islamisiert. Als Erklärung wird die wohl gleichzeitig einsetzende Toleranz der Moslems in religiösen Dingen bemüht. Diese Toleranz muß im Falle von Persiens berühmtestem Dichter noch mehr strapaziert werden. Firdausi lebte von 939 bis 1020 und beschrieb in 60.000 Doppelversen die Geschichte des iranischen Reichs bis zur arabischen Eroberung (das Schah-Name oder Königsbuch). Warum er es sich leisten konnte, dieses Epos seinem Sultan zu widmen, obwohl es weder die arabischen Heldentaten seit 651 erwähnt noch den Islam noch Allah, ist bislang unerklärt. Erst wenn die Islamisierung des Irans –beim Auskehren der Phantom-Jahrhunderte– ins 10. Jahrhundert rückt, dann klärt sich auch die persische Geschichte.
Im Iran lebten im übrigen auch die Parsen. Schon im letzten Beitrag ist erwähnt worden, daß diese Religionsgemeinschaft bis heute nicht verstanden hat, warum der Kalender ihrer Glaubensbrüder in Indien von dem im Iran geltenden um 300 Jahre differiert. Auch hier stiftet die These von den Phantom-Jahrhunderten Sinn.
Hidschra der arabische Kalender
Unser bislang frustrierender Rundgang endet bei der islamischen Kalenderrechnung. Bekanntermaßen verließ Mohammed im Jahre 622 Mekka in Richtung Medina. Diese Übersiedlung (Hidschra) wurde von Kalif Omar I. (633-644)– für eine Ära-Epoche erstaunlich früh– zum Startpunkt der islamischen Zeitrechnung erklärt. Trotzdem fehlt diesem Kalender das für uns Wesentliche: Er verbindet nicht Antike und Mittelalter, überbrückt nicht die ganze Phantomzeit (618-911). Seine frühe Einführung ist –wen wird es noch wundern – wiederum schlecht überliefert. Da es aber Münzen mit zweistelligen Hidschra-Daten gibt, führt diese Zeitrechnung immerhin von heute bis nahe den Beginn der Dunklen Jahrhunderte zurück.
Nachdem dieser Kalender ab vielleicht 640 durchgängig belegt scheint, müssen andere Überlegungen angestellt werden. Zunächst fallt auf, daß die frühe arabische Zeit ähnlich dunkel wirkt wie die entsprechende Zeit im christlichen Europa. So ist das maurische Spanien vor 930 kaum faßbar. Die Kunstgeschichte kann nur auf einige Wandbögen in der Moschee von Cordoba verweisen, die ganz allein die maurische Architektur von 711 bis fast 950 repräsentieren müssen. Dabei soll Cordoba gegen 800n. Chr. 500.000 bis 1.000 000 Einwohner gezählt haben, die in ihrer hochzivilisierten Stadt den primitiven Germanen vormachten, wie man riesige Bibliotheken anlegt, Straßen pflastert, Straßenbeleuchtung unterhält und zahllose Badeanstalten betreibt. Diese Weltstadt hat uns leider keine Scherbe hinterlassen, genausowenig wie die Millionenstadt Bagdad, in der Harun al-Raschid nächtens durch die Straßen gehuscht sein soll. Nachdem wir auch die großen geistigen Kulturleistungen des frühen Islams nur in Form von Zitaten kennen, die spätere Schriftsteller und Historiker berichtet haben, gilt der Verdacht, daß auch die arabische Welt bis ins 10. Jahrhundert hinein fiktiv ist.
Die Folgerungen daraus sind kaum absehbar. Wir wissen etwa, daß die islamischen Historiker des 11. bis 13. Jahrhunderts nach der Hidschra und nach Christi Geburt datiert haben. Wenn sie sich nach Otto III. der christlichen Zeitrechnung angeschlossen haben, hätten sie sich auch die Zeitlücke eingehandelt, die sie dann mit Erzählungen aus Tausendundeiner Nacht füllten. Da in Phantomzeiten keine gemeinsame Geschichte von Ost und West geschehen sein kann, passen die Erfindungen des Abendlandes und des Morgenlandes nicht immer zueinander. So gibt es keine arabischen Belege jener Gesandtschaften, die Karl der Große und seine Nachfolger nach Bagdad geschickt haben sollen, keine arabischen Berichte zur Kaiserkrönung von 800 und zu Haruns Krönungsgeschenken wie Elefant oder Orgel. Von arabischen Historikern wurde auch die epochale, europarettende Niederlage gegen Karl Martell übersehen, was die westlichen Historiker verdroß, die doch mehr als 200.000 Sarazenen südlich der Loire hatten liegen sehen wollen.
Damit kommen wir zu dem Rätsel, wie die Araber so schnell die halbe Welt erobern konnten. Binnen 99 Jahren (633–732) stoßen sie im Westen bis zur Loire vor, binnen 118 Jahren (633–751) erreichen sie Zentralasien –eine überdimensionale Zangenbewegung mit einem Ausgriff von 7.500 km. Bei diesem unaufhaltsamen Vordringen werden die ersten vier Kalifen und der Sohn des vierten ermordet (634, 644, 656, 661, 680). "Normalerweise" hätten immer neue Blutfehden die Araber ins finsterste Chaos stürzen müssen– statt dessen fanden sie erstmals richtig zusammen.
Die frühe arabische Geschichte muß deshalb insgesamt überprüft werden. Ist sie ganz anders verlaufen, ist sie eher persische Geschichte, lebte Mohammed schon im 4. Jahrhundert, was aus religionsgeschichtlicher Sicht möglich wäre und. die Hidschra-Daten bestäigen würde? Erst dann wird sich auch das Rätsel unserer Abbildungen lösen. Bislang ist schwer verständlich, warum arabische Münzen des 8. und 9. Jahrhunderts den islamischen Vorgaben –unter anderem keine Darstellung von Menschen und Tieren– rigid entsprechen, während im frühen 10. Jahrhundert sehr wohl Pferde. Reiter und musizierende Personen abgebildet werden, als ob der endgültige Kanon islamischerKunst noch gar nicht definiert war.
Doppeltes Fazit
Wir sind zu zwei Ergebnissen gekommen. Zum einen müssen wir akzeptieren. daß unser bisheriges Geschichtsbild des frühen Mttelalters keiner kritischen Betrachtung standhält. Selbst die verschiedenen Zeitrechnungen, die doch das Rückgrat aller Geschichte bilden, verschleiern mehr, als sie klarstellen können . Wo wir Gewißheit und Prüfbarkeit erhoffen, stoßen wir nur auf Fehlstellen und Dunkelzeiten.
Andererseits löst die auf den ersten Blick abstrus wirkende These dreier Phantom-Jahr-hunderte Probleme, die bislang unlösbar waren und obendrein aus ganz verschiedenen Bereichen stammen. Dank ihr verstehen wir die Fundleere in Italien genauso wie die in Spanien oder Bagdad; wir verstehen, warum die Zeitrechnungssysteme der Parsen oder der Inder nicht einmal untereinander kompatibel sind; wir verstehen, warum ein alter Engländer sehr "voreilig" die Null verwendet und eine berühmt irische Handschrift wie das Book of Kells afghanische Farben aufweist, obwohl um 800 kein Fernhandel möglich gewesen sein soll (das berühmte Manuskript stammt in Wahrheit aus der Zeit um 1000); wir begreifen die Jahrtausendwende-Hysterie in Frankreich und die Datumsänderungen in "deutschen'' Urkunden, die bislang kaiserlichen Notaren fortgeschrittene Verblödung attestierten. Wir verstehen jetzt auch, warum die Juden zeitweilig das Schreiben vergessen haben und während des frühen Mittelalters "untertauchen"; wir verstehen, daß die Araber einfach Karl Martell übersahen; wir verstehen, daß ein Perser des 10. Jahrhunderts nur eine sassanidische Vergangenheit schildern konnte und daß der Iran damals noch kaum islamisiert war. Wieviel Sinn muß eine These stiften, bevor auch die zuständigen Fachgelehrten ihren Wert erkennen?
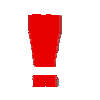 Achtung!
Achtung!